Die Pfarrei Maria Königin In der Kalkeifel besteht aus 5 fusionierten Pfarrgemeinden. Ca. 2250 Katholik*innen leben hier verteilt auf insgesamt 17 Wohnorte. In 16 Orten befindet sich entweder eine Kirche oder Kapelle. In den fünf ehemaligen Pfarrkirchen wird regelmäßig am Wochenende ein Gottesdient (Eucharistiefeier bzw. in seltenen Fällen Wortgottesdienste mit Kommunionspendung) gehalten. In den Kapellen finden Gottesdienste dagegen meist nur alle 3-4 Wochen statt. Das Pfarrbüro der Pfarrei befindet sich im ehemaligen Kloster in Niederehe.
Aktuelles aus der Pfarrei
fusionierte Pfarreien
Seelsorger*innen
Kontakt zur Pfarrei Maria Königin In der Kalkeifel

Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Dienstag - Freitag: 10:00 Uhr-12:00 Uhr
Donnerstag: 15:00 Uhr-18:00 Uhr
Pfarrsekretärinnen:
Birgit Fries, Sekretariat
Christiane Rauch, Urlaubsvertretung
Wir sind für sie da!
In dringenden seelsorglichen Notfällen wenden Sie sich an Pfarrer Lück im Pfarrhaus (02696-1307). Zudem haben wir eine Notfallnummer, die ständig weitergeleitet wird: 02696-9319920. Bitte sprechen Sie auch auf den AB. Wir rufen zurück!
Mit alten Handys Gutes tun
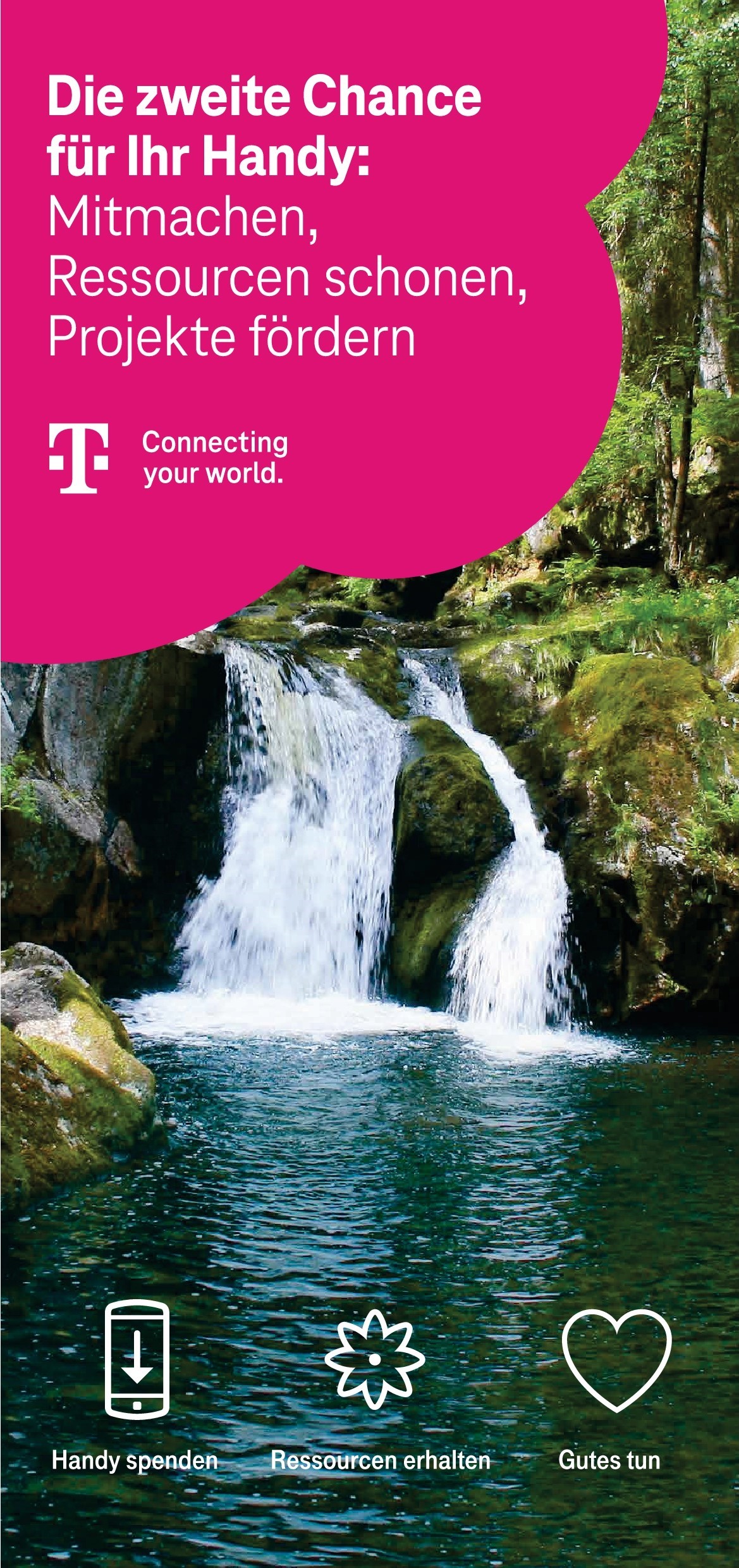
Gebrauchte Handys schonen Ressourcen: Jetzt mitsammeln!
Mehr als 200 Millionen gebrauchte Handys liegen ungenutzt und vergessen in deutschen Schubladen. Millionen Möglichkeiten, einfach und aktiv Ressourcen zu schonen. Vor allem die Weiterverwendung gebrauchter Handys bzw. deren fachgerechtes Recycling kommen der Umwelt zugute. Wie? Durch die Rückgabe Ihres gebrauchten Handys im Rahmen unserer Handysammelaktion – DEKRA-auditiert und mit garantierter Datenlöschung. Sie möchten mehr über die Sammelinitiative mit dem größten Spendenvolumen seit 2003 in Deutschland erfahren? Schauen Sie einfach unter www.handysammelcenter.de
Sie können Ihre alten Handys in den Kirchen und Pfarrbüros im Pastoralen Raum Adenau-Gerolstein abgeben. Der Erlös, der über unsere Sammelstelle erzielt wird, kommt dem katholischen Hilfswerk missio zugute.
Bei Fragen zur Handysammelaktion wenden Sie sich gerne an Philipp Hein.
Kindertreff Üxheim

An jedem 2. Freitag im Monat findet der Kindertreff der Pfarrei Maria Königin In der Kalkeifel statt. Von 16 bis 18:00 Uhr bereiten Jugendliche ein Angebot für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren vor. Aktuell treffen wir uns meistens im Üxheimer Bürgerheim in der Schulstraße zum Spielen und Basteln. In einer Infogruppe gibt es Informationen über das geplante Programm. Weitere Auskunft gibt Philipp Hein.
Die Kinder können einfach kommen, wenn sie Zeit und Lust haben. Es ist keine Anmeldung erforderlich und es entstehen keine Kosten.
Beim ersten Besuch bitten wir ein Formular mit den wichtigsten Daten auszufüllen. Dieses kann hier heruntergeladen werden:
Orgelkonzerte
An der berühmten Balthasar König Orgel in Niederehe finden auch in diesem Jahr verschiedene Orgelkonzerte statt. Weitere Informationen finden Sie auf www.orgel-niederehe.de
Büchereien:
Nohn
Donnerstag 17-18 Uhr
Üxheim
Dienstags: von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr
Mittwochs von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr
Kirchen, Kapellen und sonstige Einrichtungen
Das Kloster St. Leodegar in Niederehe (Eifel)
Das Kloster St. Leodegar in Niederehe (Eifel)
Von Professor Dr. Ferdinand Pauly, chronologisiert und aktualisiert von I. Berens
947 – 971 Ort Niederehe erstmals als „Hiea“ urkundlich erwähnt in einem Tauschvertrag des 11. Prümer Klosterabts Ingramnus. 1148 ist Niederehe schon Pfarrort für die Umgebung. 1175: Die Söhne Heinrichs I. von Kerpen, Albero, Alexander und Dietrich, sowie deren Schwestern bauen auf ihrem Grund ein Kloster für adelige Jungfrauen nach der Augustinerregel. Das Kloster bekommt an zahlreichen Orten Besitzungen, und ist daher wirtschaftlich gut gestellt.
Der Kölner Erzbischof Heinrich unterstellt 1226 das Frauenkloster Niederehe der Aufsicht der Prämonstratenserabtei Steinfeld. Damit war die Übernahme der Prämonstratenser regel verbunden. Die Zahl der Mitglieder (Nonnen) wurde auf 25 Mitglieder beschränkt.
Im 13. Jh. - 14. Jh. Vermehrte sich das ursprünglich kärgliche Stiftungsgut, durch Schenkungen des Adels, beträchtlich. Im Jahre 1322 bewilligen von Avignon aus Aegidius, Patriarch von Jerusalem und andere Bischöfe, den „Monasterio Sti. Leodegari“ ( zahlreiche Ablässe ). Ein großer Zustrom von Pilgern und Wallfahrern setzt bald ein. Wohlhabenheit und schlechte Verwaltung lassen die Klosterzucht absinken. Alsbald treten Schulden an die Stelle bisheriger Überschüsse. Anfang des 15. Jh. tritt Friedrich von Sombreff, Herr zu Kerpen, als Nachfolger der Stifterfamilie sein Amt an und schlägt die Aufhebung des Frauenklosters und eine Besetzung mit Chorherren aus Steinfeld vor. Er kann damit nicht durchdringen, da die Angehörigen der Schwestern Einspruch erheben.
Dann im Jahre 1475 vernichtet ein großer Brand das Klostergebäude und einen Teil der Kirche. Man sieht darin eine Strafe des Himmels für die eingerissenen Missstände.
1485 wird als Hausgeistlicher nicht mehr ein Prömonstratenser aus Steinfeld, sondern der Weltpriester Johannes Knauf aus Habscheid eingesetzt. Steinfeld scheint an Niederehe nicht mehr interessiert zu sein.
1505: Ein Menschenalter nach dem Brand, kommt es doch zu der bereits früher erstrebten Umwandlung. Sie erfolgt in Zusammenarbeit zwischen Dietrich von Manderscheid-Schleiden (und seiner Gemahlin Margarethe von Sombreff) mit der Abtei Steinfeld. Am 22. August 1505 wird die wiederhergestellte Kirche durch den Kölner Weihbischof konsekriert und 1507 der Neubau des Klosters vollendet, in das Prämonstratenser aus Steinfeld, unter Leitung eines Priors, einziehen.
1541: Die Herren von Manderscheid-Schleiden betrachten sich als Erben des Herren von Sombreff und damit der Stifter aus dem Geschlecht der Herren von Kerpen. Gegen den Widerstand der Abtei Steinfeld, betreiben sie beim päpstlichen Gesandten in Regensburg, die Zustimmung zur Verlegung des Klosters von Niederehe nach Schleiden, dringen damit jedoch nicht durch. Dann wird im Jahre 1567 der Bestand des Klosters ernstlich bedroht, als die Herren von Manderscheid-Schleiden sich zur Konfession bekennen und diese in ihrem Herrschaftsbereich durchzusetzen versuchen. Den Prämonstratensern in Niederehe wird mitgeteilt, wenn sie im Kloster bleiben wollen, müssten sie sich zur lutherischen Reformation bekennen. Der Konvent und der Abt von Steinfeld erheben Einspruch gegen diese Forderung, müssen es aber hinnehmen, dass der Landesherr im Jahr 1569 einen lutherischen Prediger nach Niederehe setzt. Die Kirche wird geteilt und das Schiff der lutherischen Gemeinde zugewiesen, während die Abtei Steinfeld bzw. die katholische Gemeinde in Niederehe im Besitz des geräumigen Chores bleibt.
Erst 1593 ändert sich dies, als durch Tod des kinderlosen Dietrich VI. von Manderscheid-Schleiden, das Kloster und die Pfarrei in den Besitz des Grafen Philipp von der Mark kommt. Sein Grabmal und das seiner Gemahlin Katharina von Manderscheid-Schleiden (Schwester Dietrich VI.) befindet sich heute noch im Seitenschiff der Kirche. Die Prämonstratenser
nehmen am 10. Oktober 1593 unter dem Prior Michael Wehr Kirche und Kloster wieder in Besitz. Neuer Wohlstand kehrt im Kloster ein. Somit kommt im Jahre 1715 Balthasar König, Orgelmacher, aus Münstereifel nach Niederehe, er baut sein Erstlingswerk in der Klosterkirche auf. (1998 wurde die Barockorgel durch den Orgelbauer Hubert Fasen aus Oberbettingen umfangreich restauriert. Seitdem finden regelmäßig Orgelkonzerte St. Leodegar statt.)
Von 1776-1782 erfolgt, unter dem Prior Gottfried Wachendorf, ein vollständiger Neubau des Westflügels, der nach einem Brand zerstört wurde. Letzter Prior und Rämonstratenserpfarrer in Niederehe ist Eberwin Eschweiler.
1803 löst Napoleon I. das Kloster auf und versteigert 1804 die Klostergüter, lediglich die Kirche und ein Teil des Klostergebäudes verbleiben der Pfarrgemeinde. Der Kloster Kirche-Bering wurde 1985 zur Denkmalzone erklärt.
Zur alten Pfarrei Niederehe gehören seit 1197 die Filialorte Kerpen, Loogh und Heyroth. Ursprünglich gehört die Pfarrei zum Eifeldekanat, das der Erzdiözese Köln untersteht. Im Jahre 1821 wird sie trierisch und 1859 dem Dekanat Hillesheim zugeteilt.
Balthasar König Orgel
Die ehemalige Klosterkirche St. Leodegar in Niederehe birgt einen einzigartigen Schatz:
Die Kirchenorgel des berühmten Orgelbaumeisters Balthasar König.
Das Barocke Kleinod wurde im Jahr 1715 als erstes Werk Königs in Niederehe errichtet und ist die älteste Kirchenorgel in Rheinland-Pfalz.
Orgelkonzerte finden ca. 4 mal im Jahr statt. Orgelfreunde der „kleinen Königin“ in Niederehe, können sich über anstehende und zukünftige Konzerte in Niederehe, unter www.orgel-niederehe.de informieren. Bitte melden Sie sich auch dort für den Newsletter an.
Die Organisationsleitung hat Herr Dr. med. Kai Becker.
Über das Kath. Pfarramt Niederehe sind verschiedene CD's zu beziehen.
- "Von Andrieu bis Zipoli". CD 73 Min. Orgel:: Josef Eich Preis 13,50 € zzgl. Porto
- Johann Mattheson "Les doits parlans" "Die wohlklingende Fingersprache" Orgel: Gerd Zacher, Preis: 17,50 € zzgl. Porto.
- Johann Caspar Ferdinand Fischer: "Blumenstrauß". Das gesamte Orgelwerk des Komponisten auf einer CD. Srge Schoonbroodt. Preis 17,50 € zzgl. Porto.
- Johann Caspar Kerll (1627-1693) "Scaramuza" Léon Berben an der Balthasar-König-Orgel. Preis 17,50 € zzgl. Porto.
- Eine besondere Orgel CD ist zum 300-jährigen Jubiläum erhältlich:Zum Orgeljubiläum ist die Orgel-CD, eingespielt von Josef Still, Domorganist in Trier, neu aufgelegt worden. Sie ist zum Preis von 15 € im Pfarrbüro erhältlich und ist sicherlich nicht nur schön zum selber hören, sondern auch ein schönes Geschenk. Gerne verschicken wir die CD auch für Sie.
Bei Interesse wenden Sie sich gerne telefonisch oder persönlich ans Pfarrbüro unter 02696-1307.
Vierzehn Nothelfer
Filiale Loogh
Geschichtlich wurde der Ort Loogh - mit heute 100 Einwohnern - bereits 1218 durch eine Schenkung von zwei Hofstätten, den Keulen-Häusern, durch die Herren von Kerpen an das Kloster in Niederehe erstmalig urkundlich erwähnt.
Naturfreunden ist der Ort Loogh durch sein Wacholder-Naturschutzgebiet am Hönsel-Berg mit seiner seltenen Blumen- und Pflanzenwelt, darunter viele Orchideenarten, bekannt. Ruhe, Beschaulichkeit und Natur bietet der Ort; sowie die Möglichkeit, auf schönen Wanderwegen durch Wiesentäler und Wälder die Schönheit der Eifel zu erkunden. Alle 2 Jahre findet ein Dorffest statt.
Hl. Stephanus und Hl. Sebastianus
Kerpen
Die heutige Kapelle z.E. der hl. Stephanus und Sebastianus ( so schon 1703 ), Anfang des 16. Jh. als Schlosskapelle erbaut, hat gewiss eine Vorgängerin gehabt, dann 1486 wird Johann v. Gillenfeld als Rektor der St. Johannes-Baptistenkapelle erwähnt; 1496 quittiert Johann Heydendall, Priester der Vorburgskapelle z.E. des hl. Johannes Baptist in Kerpen, von Ww. Kath. v. Mirbach 20 Gulden für eine Jahrmesse empfangen zu haben. Diese Kleriker waren somit Burgkapläne wie die später genannten, die ein gutes Einkommen, wie z.B. Thiel 100 Taler, bezogen.
Die Anlage, wohl 1645 und nochmals 1903 renoviert, ist durch eine Mittelsäule zweischiffig gestaltet. Das gerade geschlossene Chor ist im Lichten 7,08 m breit und 4,30 m tief, das Schiff 10,12 m lang und 7,58 m breit.
Der große Mittelschlussstein trägt die Muttergottes als Himmelskönigin; links auf dem Gurt das Wappen des 1551 verstorbenen Grafen Diedrich v. Manderscheid, der 1506 die Magaretha v. Sombreff als Gattin heimgeführt hatte und der wohl der Erbauer unserer Kapelle gewesen ist.
Der Hochaltar, Holz, ein Säulenaltar von 1791, ist Nachfolger eines 1665 gestifteten neuen Altares.
1719 ist ein Seitenaltar vorhanden, heute deren zwei mit Ölgemälden, das Martyrium der hh. Stephanus und Sebastianus darstellend, die Meister Osterspey in Antweiler vor 1778 geliefert hatte. Die Kanzel kam 1789, das Gestühl wohl 1681; dann noch zwei kleinere Holzfiguren. Die Kapelle war 1830 im Besitz zweier Glocken von 1674 und 1732; die Inschriften lauteten: Anno 1674 Joannes Wickroth me fecit; die zweite größere: Diese Glocke verehrte die Gemeinde zu Kerpen in der Eifel zu Gottes Ehr. Michael Koll hat mich gegossen in Coeln anno 1732.
Da eine unbrauchbar geworden, lieferte Mabillon* 1872 eine neue. Beide gingen im 2. Weltkrieg verloren und wurden durch zwei Stahlglocken ersetzt.
1975/76 wurde die Kapelle vorbildlich renoviert und teilweise umgestaltet.
Heyroth
Die St. Antoniuskapelle in der Filiale Heyroth wurde 1745/47 erbaut, als einfach geputzter Bruchsteinbau, im Lichten 5,45 m breit und mit dem dreiseitigen Chorschluß 10,95 m lang. Das Innere der Kapelle ist im "spätem Bauernbarock"geschaffen. Auf dem Hauptaltar aus dem 18. Jahrhundert steht, eingefaßt von zwei verzierten Säulen, ein Ölgemälde des hl. Antonius. Rechts und links davon befinden sich Holzfiguren des hl. Antonius und der hl. Katharina. Den oberen Abschluß des Altares bildet die Figur der Muttergottes mit dem Kind in einer Strahlenglorie; ihr zu Füßen knien Engel. Auch der Altartisch weist ein Gemälde des Kirchenpatrons St. Antonius auf. In den Altar eingearbeitet sind Reliquien der hl. Ursula und Gefährtinnen. An den Seitenwänden rechts und links vom Altar befinden sich Figuren der Muttergottes und des hl. Hermann Josef.
Über dem Eingang stand eine Holzfigur des Kirchenpatrons, diese musste 1996 durch eine nachmodellierte Figur aus Mainsandstein ersetzt werden.(Künstler Christoph Fischbach)
Auch die Kirchenbänke, mit kunstvollen Schnitzereien versehen, sind noch aus dem 18. Jahrhundert.
Die sechs Rundbogenfenster mit Bildern der hl. Mauritius, Katharina, Elisabeth, Antonius, Aloisius und Isidor wurden in den 20er Jahren zu Ehren der Gefallenen des ersten Weltkrieges gestiftet.
Pfarrei Nohn
Historie
Unsere Pfarrkirche St. Martinus wurde im Jahre 1781 an Stelle einer älteren Kirche aus dem 10. Jhd. , errichtet; von diesem gotischen Vorgängerbau stammt noch der Turm aus dem 16. Jhd, der im 19. Jhd mit einem neuromanischen Portal versehen wurde. Sie ist dem heiligen Martin von Tours geweiht. Obwohl mehrfach Veränderungen an der Kirche vorgenommen wurden, befindet sie sich heute praktisch noch im Originalzustand. Beichtstühle und Kanzel stammen aus dem 18. Jhd. Die barocke Orgel wurde 1868 eingebaut. Sie wurde in Trier aber schon um 1720 gebaut und dort zunächst in der Abtei St. Matthias eingesetzt.
Die verputzten Bruchsteinmauern besitzen je vier Rundbogenfenster an den Seiten des Kirchenschiffs und weitere im Chor.
Im Osten wurde nach 1830 eine Sakristei angebaut.
Im Jahre 1801 wurde aus Nohn eine eigenständige Pfarrei mit den heutigen Filialen Trierscheid, Dankerath und Senscheid
Kapelle Senscheid
Die Kapelle in Senscheid wird erstmals im Jahre 1683 erwähnt. Die heutige Kapelle wurde 1875 und 1876 erbaut und ist den hl. Peter und Paul geweiht. 1881 erhielt sie zwei Glocken, die jedoch im 2. Weltkrieg eingeschmolzen wurden.
Die Senscheider Kapelle enthält den wohl ältesten und wertvollsten Altar der Filialen. Der Barockaltar aus der Zeit um 1700, in dessen Mittelteil eine aufwändig gearbeitet Statue steht, die Mara als Himmelskönigin mit Zepter und Jesuskind zeigt. Zu ihren Füßen ist eine Mondsichel zu sehen. Auf dem Abschluss steht eine aus Holz gearbeitete Statue von St. Petrus, der Buch und Schlüssel in seinen Händen hält und der von St. Paulus- und St. Apollinaris-Standbildern flankiert wird. Die Buntglasfenster zeigen gemalte Heiligenbilder.
Im Jahr 2007 wurde ein moderner Altartisch, in den der Stein aus dem alten Altar eingearbeitet wurde, und ein Lesepult gebaut. Auf diesem quadratischen Sandsteinblock sind unter anderem fünf Kreuze eingraviert, die für die fünf Wundmale Jesu stehen.
Kapelle Trierscheid
Die Kapelle in Trierscheid St. Antonius stammt aus dem Jahr 1884, erwähnt wurde eine Kapelle bereits im Jahr 1683.
Die flachbogige Einfassung des Portals, die um das Jahr 1765 angefertigten Bänke sowie ein spätgotisches Fenster mit Maßwerk in Kleeblattform wurden ebenso aus der alten Kapelle übernommen wie der barocke Holzaltar aus dem 17. Jahrhundert. In den 60er-Jahren wurde dieser allerdings durch einen neugotischen St. Josef-Altar ersetzt.
Bei Renovierungsarbeiten im Jahre 1964 fanden Arbeiter eine 200 Jahre alte Altarplatte aus Stein, die heute wieder ihren ursprünglichen Zweck erfüllt.
Die St. Josef-Statue wurde im März 1981 erneuert. In den Jahren 1983 bis 1987 wurde die Kapelle saniert, u.a. wurde das Dach repariert, die alten Holzbänke neu restauriert und die Kapelle sowohl innen als auch außen angestrichen. Vom Jagdpächter wurde eine neuer Wetterhahn gestiftet.
Kapelle Dankerath
Erstmals wurde im Jahre 1683 eine Kapelle in Dankerath erwähnt.
Die heutige Kapelle St. Nikolaus in Dankerath wurde im dem Jahr 1912 errichtet und am 09. Dezember 1913 geweiht.
Die Kirche besitzt an den Traufseiten je drei Rundbogenfenster, die 1989 einfache Bleiglasfenster erhielten. Ein dreiseitiger Chor schließt die Kapelle im Osten ab. Auf dem Satteldach mit Krüppelwalm sitzt ein rechteckiger Dachreiter mit Haube, die von einem Kreuz auf der Spitze bekrönt wird.
Der Altar aus dem 20. Jahrhundert, von einem Schreinermeister aus Kerpen geschaffen, besitzt sieben Statuen. In der Mitte Jesus, flankiert vom hl. Nikolaus, der Gottesmutter Maria, dem hl. Josef, dem hl. Franz von Assisi, der hl. Therese von Lisieux und der hl. Elisabeth von Thüringen.
Erste Pfarrkirche Oberehe, Gemeinde Oberehe-Stroheich
Beschreibung
Diese Kirche, dem heiligen Apostel Jakobus geweiht, stand inmitten eines Friedhofes links der Obereher Burg am Torgebäude. Sie war ein einschiffiger Bau mit kleinem rechteckigen Chorhaus und schmaler Sakristei. Erbauung vermutlich zu Beginn des 16. Jahrhunderts durch die Ortsherren von Broel. 1734: Reparatur durch die Herren von Veyder. 1861: trotz mehrfacher Restaurierungen in der Vergangenheit zeigen Schiff, Sakristei und Turm starke Risse; von Baufälligkeit wird gesprochen; die königl. Regierung sieht die Notwendigkeit eines Neubaues ein. 1901: Grundsteinlegung und 1902: Einsegnung der neuen Pfarrkirche. 1901: Abriss der alten Kirche; Verkauf des Kirchenplatzes. Wenige hundert Meter entfernt, Richtung Hillesheim, steht die neue Pfarrkirche, in der sich vieles an Mobiliar und an Kultgeräten der alten Kirche befindet. Grabsteine der Gönnerfamilie von Veyder wurden ebenso mit übernommen wie eine alte Glocke von 1480. An der Stelle der ehemaligen Kirche ist heute ein schlichtes großes Holzkreuz in die Burgmauer eingelassen. Quelle: Schug: Geschichte der Pfarreien Adenau, Daun, Gerolstein, Hillesheim und Kelberg (Trier 1956), Seite 423; Wackenroder. Die Kunstdenkmäler des Kreises Daun, S. 193.
Einordnung Kategorie: Bau- und Kunstdenkmale / Sakralbauten / Kapellen
Zeit: Beginn des 16. Jahrhunderts
Epoche: Renaissance
Lage: Geographische Koordinaten (WGS 1984) in Dezimalgrad:
lon: 6.771707 lat: 50.278759
Lagequalität der Koordinaten: Vermutlich Flurname: Ortslage
Internet www.jahrbuch-daun.de/VT/hjb1986/hjb1986.96.htm
Hl. Agatha
Filialkapelle Stroheich
Sankt Agatha
Stroheich, Gemeinde Oberehe-Stroheich
Gartenstraße
Katholische Filialkirche
Saalbau, Anfang des 16. Jahrhunderts; Schaftkreuz, bezeichnet 1759. [1] Anfang 16. Jahrhundert. Im Chor spätgotische Malereien: Wandbild einer Kreuzigung. [2] Die katholische Kapelle ist ein einheitlicher Bau des 16. Jahrhunderts mit im Grundriss quadratischem Chor und Westturm. Als Bruchsteinbau schlicht geputzt. Der Chor mit Sternengewölbe. In zwei Schlusssteinen bürgerliche Wappen. Spitzbogiger Triumphbogen mit Hohlkehle. Das Schiff war früher gerade gedeckt. Jetzt mit höher liegender Voutendecke. Fenster bei der Instandsetzung im Jahre 1824 verbreitert. Im Inneren Tabernakelaltar des 18. Jahrhunderts und einfache Holzfiguren des 18. Jahrhunderts. Einfaches Kniegestühl mit Rokokomotiven auf den Wangen. [3]
Einordnung
Kategorie:
Bau- und Kunstdenkmale / Sakralbauten / Katholische Kirchen
Zeit:
16. Jahrhundert
Epoche:
Renaissance
Lage:
Geographische Koordinaten (WGS 1984) in Dezimalgrad:
lon: 6.754122
lat: 50.285378
Lagequalität der Koordinaten: Genau
Flurname: Ortslage
Datenquelle
[1] Denkmalliste der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Rheinland-Pfalz; 2010. [2] Georg Dehio: Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler: Rheinland-Pfalz, Saarland, 1984. [3] Ernst Wackenroder, Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz.
Maria Himmelfahrt
Pfarrkirche Üxheim
Üxheim wurde im Jahre 844 erstmals urkundlich erwähnt und ist seit 970, wahrscheinlich aber schon früher Pfarrort. Denn damals gibt Graf Heinrich die Eigenkirche Üxheim mit Kapellen zu Nohn, Barweiler, und Ahrdorf der Abtei St. Maximin zurück. Von dieser Kirche ist nichts mehr erhalten. Sie soll der Überlieferung nach auf dem heutigen Kirberg (Kirchberg) gestanden haben. Um 1200 war eine neue Kirche gebaut worden, welche um 1500 durch Feuer zerstört wurde. Von der Nachfolgekirche, die im 19. Jahrhundert zur Schule mit Lehrerwohnung umgebaut wurde, stehen heute noch Chor und Sakramentshäuschen.
Das heutige Gotteshaus, ein einfacher Hallenbau, wurde 1835/ 1836 errichtet und in alter Tradition der Gottesmutter (Maria Himmelfahrt) geweiht. Besondere Erwähnung verdienen das schwere Bronzeportal mit Motiven der Aufnahme Mariens in den Himmel sowie die Kreuzigungsgruppe über dem Hauptaltar mit dem Gekreuzigten, seiner Mutter und Johannes, Werke des italienischen Pfarrers und Künstlers Don Luciano Carnessali und eine Schenkung seiner hier lebenden Bruders Bruno und seiner Frau Gisela. Tabernakel und neues Taufbecken stammen von dem hiesigen Bildhauer Ulrich Henn. Die 6 handgemalten Fenster im Kirchenschiff aus schweizer Rauten mit Brustbildern verschiedener Heiliger stellen in unserer Zeit eine Kostbarkeit dar. Eine echte, eher unauffällige Rarität steht links im Chor, das romantische Taufbecken aus Rotsandstein, ein Zeugnis aus dem alten Gotteshaus und von fachkundiger Seite als das "beste Stück" in unserer Kirche bezeichnet. Die Orgel wurde 1843 von der Pfarrei Liebfrauen in Trier erworben. Der barocke Orgelprospekt ist ein Meisterwerk. Seit 2006 hängen im Turm 4 neue Bronzeglocken.
Hl. Josef
Kapelle Ahütte
Die Kapelle St. Josef in Ahütte
Ahütte ist benannt nach einer Eisenhütte an der Ahe (Ahbach), welche die Herzöge von Arenberg betrieben. Diese stifteten die schöne Kapelle. Alte Chronisten bezeichnen sie als "malerisch wirkendes Gotteshaus". In einer Muschelnische des Altars aus dem Jahre 1705 steht die Statue des hl. Josef. Die Kapelle wurde im 2. Weltkrieg durch Bomben stark beschädigt, später aber wieder hergestellt und wiederholt restauriert.
St. Katharina
Kapelle Leudersdorf
Im Jahre 1683, wahrscheinlich aber schon viel früher, stand im Filialort Leudersdorf eine Kapelle. Die jetzige ist 1734 erbaut. Eine Besonderheit ist der achtseitige Schieferturm mit zweimal aufeinanderfolgenden Zylinder- und Zwiebelform, durch Gesimse unterbrochen. Der Hochaltar aus der Zeit um 1700 stammt wohl aus der alten Kapelle. Die Fenster tragen die Namen der Gefallenen des 1. Weltkrieges, eine Tafel erinnert an die des 2. Weltkrieges. Die Kapelle hatte von alters her verhältnismäßig reiche Einkünfte, sehr zum Nutzen der Bürger (Geldausleihe), und nicht zuletzt zu verdanken dem großherzigen Gönners Jakobus Ramers (+1743), dessen Andenken die Gemeinde mit einem Basaltkreuz am Wendalinusheiligenhäuschen bis auf den heutigen Tag ehrt.
Pfarrkirche Walsdorf
Die erste Kirche von Walsdorf stand auf dem Spiegelberg (=Arnulphusberg) und wurde zwischen 1375 und 1385 urkundlich erwähnt.
Diese Kirche verfiel im laufe der Zeit jedoch immer mehr und stand im Jahre 1820 nur noch als Ruine da.
Im Jahr 1828 errichtete man im jetzigen Pfarrort Walsdorf die heutige Pfarrkirche.
Für den Bau des neuen Gotteshauses verwendete man teilweise das Material der alten Kirche vom Arnulpusberg. Auch das Inventar wurde größtenteils in die neue Pfarrkirche übertragen. Dies zu bewerkstelligen waren unsere Vorfahren unter sehr schwierigen, wirtschaftlichen Verhältnissen bereit.
Als Schutzpatron für die neue Kirche wählte man den den hl.Arnulphus, welcher auch schon der alten Kirche auf dem Arnulphusberg als Schutzheiliger gedient hatte.
Die Kirche wurde als einfache Anlage, im damaligen gebräuchlichen Scheunenstil, erbaut. Der Turm, ca. 27 Meter hoch, ist an der Ostseite gegenüber vom Haupteingang errichtet.
1872 wurde eine gebrauchte Orgel gekauft. Diese stammte aus der Klosterkirche Kalvarienberg-Ahrweiler. Es ist eine Orgel mit dreiteiligem Orgelprospekt aus dem 17.Jahrhundert. Der Kaufpreis betrug seinerzeit 150 Taler.
Das Geläut stellt sich wie folgt dar:
1. Marienglocke Ton: f Gewicht: 1100 kg
2. Arnulpusglocke Ton: g Gewicht: 720 kg
3. St. Josephglocke Ton: a Gewicht: 500 kg
4. Margaretenglocke Ton: b Gewicht: 410 Kg
Die Arnulpusglocke stammt aus dem Jahr 1594 und hing schon im Turm der alten Kirche am Arnulpusberg. Die drei anderen Glocken wurden 1962 in der Glockengiesserei Mark in Brockscheid gegossen und im selben Jahr fand die feierliche Glockenweihe statt.
Seit der Errichtung des neuen Gotteshauses wurde und wird immer wieder Renoviert und Instandgesetzt, denn unsere Kirche soll für uns und unsere Nachkommen erhalten bleiben.
Ausführlichere Darstellung und Beschreibung kann man in der "Dorfchronik Walsdorf-Zilsdorf" nachlesen.
Ort Zilsdorf
Urkundlich erwähnt wurde Zilsdorf im Jahre 816. König Ludwig bescheinigte am 22. März des gleichen Jahres der Äbtissin Anastasia vom Kloster Horreum (Ören) in Trier, den Besitz eines Gutes in Ziolfi Villa. Diese Bestätigung ist der älteste amtliche Nachweis über die Existenz unseres Dorfes.
Kapelle Zilsdorf



"Zilsdorf, 1353 an Kurtrier verkauft und bis 1803 zum Amte Daun gehörend, besaß vor der heutigen Kapelle schon ein Oratorium (nicht dem allgemeinen Gottesdienste gewidmete Nebenkirche), das 1713 und 1716 im guten Zustand sich befindet".
Die Kapelle, dem heiligen Antonius von Padua geweiht, wurde 1815 neu erbaut. Sie wurde als Zweiachsiger Saalbau errichtet. Am 24.06.1722 wurde die erste Glocke vom Prior Brand aus dem Kloster Niederehe, geweiht. Damals noch zu Ehren der hl. Donatus und Benediktus. 1838 trat eine neue Glocke ihren Dienst an und 1942 letztendlich das jetzige Glöcklein, dem hl.Antonius von Padua geweiht.
Die Kommunionbank in der St.Antoniuskapelle stammt aus dem 18.Jahrhundert. (Quelle: Dorfchronik Walsdorf-Zilsdorf)






















